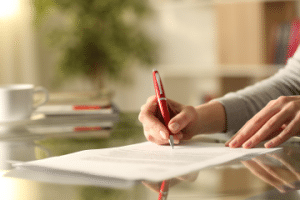
Möchten Arbeitgeber verhindern, dass ihre Mitarbeiter zur Konkurrenz übergehen, können sie nach deutschem Arbeitsrecht eine Konkurrenzklausel im Arbeitsvertrag verankern. In Deutschland besteht allerdings nicht nur die Möglichkeit, Arbeitnehmern den Wettbewerb mit dem Arbeitgeber mithilfe dieser Klausel zu untersagen. Es gilt auch das sogenannte Konkurrenzverbot.
Obwohl beide Begriffe ähnlich klingen und im Kern den gleichen Zweck erfüllen, unterscheiden sie sich in wichtigen Punkten voneinander. Welche das im Detail sind, erfahren Sie im nachfolgenden Text.
Inhalt
Kompaktwissen: Konkurrenzklausel
Die Konkurrenzklausel ist eine Art von Beschäftigungsverbot. Dieses gilt nicht während Ihrer Betriebszugehörigkeit, sondern bezieht sich auf die Zeit nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Mehr dazu lesen Sie hier.
Solange eine Konkurrenzklausel kein absolutes Berufsverbot für den Arbeitnehmer bedeutet (d. h. es ist grundsätzlich möglich, in der jeweiligen Branche erneut Arbeit zu finden), gilt sie in der Regel als zulässig. Ihre Gültigkeit ist jedoch auf maximal zwei Jahre beschränkt. Mehr dazu in diesem Abschnitt.
Ja. Verstoßen Sie gegen die Konkurrenzklausel, wird in Deutschland bspw. eine Vertragsstrafe für Sie fällig. Diese müssen Sie an Ihren ehemaligen Arbeitgeber auszahlen. Kommt er zu Schaden (z. B. weil die Firma Kunden verliert), kann er zusätzlich einen Anspruch auf Schadensersatzzahlungen erheben.
Rechtsgrundlage: Konkurrenzklausel vs. Konkurrenzverbot

Bei welchen Unternehmen gibt es ein Konkurrenzverbot? Und worin besteht der Unterschied zur Konkurrenzklausel? Laut deutschem Gesetz unterliegt jeder Arbeitnehmer der Pflicht, seinem derzeitigen Arbeitgeber loyal und treu gegenüber zu sein.
Dazu gehört unter anderem, neben der eigentlichen Erwerbstätigkeit im Unternehmen des Arbeitgebers nicht noch eine andere bei der Konkurrenz des Unternehmens aufzunehmen.
§ 60 des Handelsgesetzbuchs (HGB) regelt dieses gesetzliche Konkurrenz- bzw. Wettbewerbsverbot bspw. konkret für kaufmännische Angestellte. § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bezieht sich hingegen auf die allgemeinen Loyalitätspflichten aller anderen Arbeitnehmer. Darin heißt es:
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
§ 242 des BGB
Diese gesetzliche Pflicht gilt während Ihrer gesamten Betriebszugehörigkeit und kann mitunter noch arbeitsvertraglich angepasst werden. Arbeitgeber haben allerdings auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Arbeitnehmern darauf zu verständigen, dass sie sich nach Vertragsende weiterhin an ein Konkurrenzverbot halten müssen.
Dazu lässt sich im Arbeitsvertrag eine sogenannte Konkurrenzklausel festlegen. Zukünftige Selbstständige und Angestellte müssen diese dann gleichermaßen befolgen. In ersterem Fall würden Sie sonst womöglich selbst zur Konkurrenz werden, während Sie in letzterem zur Konkurrenz überlaufen und dem Unternehmen dadurch schaden könnten.
Wichtig: Nicht nur ehemalige Arbeitnehmer eines Unternehmens unterstehen mitunter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einer Konkurrenzklausel. Zwischen Unternehmen in strategischer Zusammenarbeit können Konkurrenzklauseln ebenfalls Anwendung finden. In diesem Fall verhindern sie bspw., dass sie sich gegenseitig Kunden abwerben oder Geschäftsgeheimnisse an den jeweils anderen verloren gehen. Das schließt sowohl Subunternehmer- und Lieferverträge, als auch andere Kooperationen ein.
Voraussetzungen – Wann sind Konkurrenzklauseln zulässig?

Grundsätzlich ist eine Konkurrenzklausel nach deutschem Arbeitsrecht immer dann rechtens, solange die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Sie wird zwischen dem Arbeitgeber und einem volljährigen Arbeitnehmer vereinbart. Für Minderjährige ist eine Konkurrenzklausel prinzipiell immer unwirksam.
- Das Verbot wird in schriftlicher Form beschlossen. Es muss zudem klar und unmissverständlich definiert sein. So können versteckte Klauseln vermieden werden, die den Arbeitnehmer benachteiligen, ohne dass dieser ihnen bewusst zugestimmt hat.
- Der Arbeitgeber hat ein „berechtigtes Interesse“ am Verbot (z. B. weil Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden müssen).
- Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist örtlich und branchentechnisch angemessen (d. h. es beschränkt sich z. B. auf den deutschen Markt und benachteiligt Arbeitnehmer nicht auch weltweit).
- Arbeitnehmer dürfen maximal 2 Jahre in ihrer Suche nach einer neuen Erwerbstätigkeit in der gleichen Branche eingeschränkt werden. Das bedeutet, beide Parteien können sich auf eine Geltungsdauer von bis zu 2 Jahren einigen.
Wichtig: Auch wenn die Konkurrenzklausel kein Mindestgehalt voraussetzt, wie bspw. in Österreich, steht allen Arbeitnehmern hierzulande eine sogenannte Karenzentschädigung zu. Nur wenn der Arbeitgeber Ihnen diese Entschädigung monatlich zahlt, ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot auch zulässig. Den rechtlichen Rahmen für die Höhe der Entschädigungszahlungen legt § 74 Abs. 2 des HGB fest. Demnach muss die Karenzentschädigung mindestens so hoch sein, wie die Hälfte der von Ihnen „zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen“. Dazu gehören nicht nur Ihr Gehalt, sondern auch etwaige Boni oder Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld etc.).
Können Konkurrenzklauseln unwirksam bzw. unverbindlich sein?

Lässt sich nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z. B. durch eine Kündigung) eine Konkurrenzklausel umgehen, selbst wenn beide Parteien sich vorab auf diese geeinigt haben? Ja, das ist prinzipiell möglich. Das betrifft bspw. mündlich ausgesprochene Wettbewerbsverbote. Wenn Ihr Arbeitgeber sich weigert, Sie für das Verbot finanziell zu entschädigen, macht das die Klausel ebenfalls unzulässig.
Sie können sich aber auch selbst weigern, sich an das Verbot zu halten. Missachten Sie die Konkurrenzklausel, kommt eine Konventionalstrafe nach § 75c Abs. 1 des HGB auf Sie zu.
Wichtig: Bei einer Konventionalstrafe handelt es sich um eine Vertragsstrafe. Diese vereinbaren Sie vorab mit Ihrem Arbeitgeber für den Fall, dass Sie das nachvertragliche Konkurrenzverbot nicht einhalten. Ihr Arbeitgeber kann diese Strafe dann gemäß § 340 Abs. 1 des BGB zumeist in Form einer Einmalzahlung als Entschädigung einfordern. Schadensersatzansprüche fallen zusätzlich an, wenn Ihr Verstoß Ihrem ehemaligen Unternehmen nachweislich geschadet hat (z. B. weil Kunden verloren gingen).
Unverbindliche Konkurrenzklauseln stellen es Ihnen als Arbeitnehmer hingegen frei, ob Sie diese befolgen möchten oder nicht. Gründe für eine solche Unverbindlichkeit sind z. B. die folgenden:
- Es liegt kein berechtigtes geschäftliches Interesse auf Arbeitgeberseite vor (§ 74a Abs. 1 S. 1 des HGB). Eine Konkurrenzklausel bspw. nur zu dem Zweck zu veranlassen, damit der Arbeitnehmer dem Unternehmen keine potenziellen Neukunden abwerben kann, zählt nicht als zulässiger Grund für ein nachvertragliches Konkurrenzverbot.
- Ihr Arbeitgeber ist bereit, Ihnen eine Karenzentschädigung zu zahlen, aber sie fällt geringer aus als das gesetzliche Minimum nach § 74 Abs. 2 des HGB.
- Das Verbot erschwert Ihnen die Suche nach einer neuen Erwerbstätigkeit auf unangemessene oder unzumutbare Weise (§ 74a Abs. 1 S. 2 des HGB). Dies betrifft bspw. den Fall, wenn Ihnen außer der Konkurrenz in Ihrem beruflichen Feld wenig bis keine Alternativen bei der Jobsuche bleiben.
- Die Konkurrenzklausel verliert ihre Gültigkeit auch nach 2 Jahren nicht und bleibt länger wirksam als gesetzlich vorgesehen (§ 74a Abs. 1 S. 3 des HGB).
- Sie reichen als Arbeitnehmer eine außerordentliche Kündigung ein, weil Ihr Arbeitgeber sich vertragswidrig verhalten hat (§ 75 Abs. 1 des HGB). Als zulässige Gründe dafür zählen z. B., wenn der Arbeitgeber Ihnen gegenüber verbal oder sexuell übergriffig wird oder sich weigert, Ihnen Ihr Gehalt auszuzahlen.
- Es kommt zu einer ordentlichen Kündigung durch Ihren Arbeitgeber. Allerdings hat dieser dafür keine personen- oder verhaltensbedingten Gründe (§ 75 Abs. 2 des HGB).
Wichtig: Eine Konkurrenzklausel kommt bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses (bspw. durch einen Aufhebungsvertrag) trotzdem zur Anwendung, sofern es nicht explizit anders im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Es empfiehlt sich daher, beim Gespräch mit dem Arbeitgeber darüber zu verhandeln, ob die Klausel in Ihrem Fall überhaupt notwendig wäre. Sollten Sie sich untereinander auf eine Aussetzung einigen, halten Sie diese schriftlich fest. So sind Sie auf der sicheren Seite, falls Ihr Arbeitgeber sich im Nachhinein trotzdem dazu entscheiden sollte, die Klausel durchzusetzen.